Auszüge aus der Ortschronik von Thalheim
ERSTERWÄHNUNG IM LEHNBUCH FRIEDRICH DES STRENGEN
GRÜNDUNG DER GEMEINDE MIT DEN ORTEN SAALHAUSEN UND KREISCHA
ÜBER DIE LANDWIRTSCHAFT IN THALHEIM
Hier können Sie die komplette Ortschronik (Ausgabejahr 2000, ca. 1,5 MB) als PDF-Datei downloaden. (Rechtsklick und Datei/Ziel speichern unter ... wählen.)
Geschichte des Ortes Thalheim
Thalheim liegt »1 halbe Stunde vom Kirchorte Alt-Oschatz südwestlich und 3 Viertel Stunde« von Oschatz entfernt.
Der Ort besteht aus 2 Gebäudereihen. Die ältesten bekannten Bewohner der Gegend waren die Hermundurer.
Um das Jahr 534 wird in den Geschichtsbüchern gemeldet, dass die Daleminzier die Oschatzer Gegend in Besitz genommen haben. Sie blieben fast ein ganzes Jahrhundert hindurch größtenteils ruhig und beschäftigten sich mit der Viehzucht und Kultur des Landes. Sie waren immer der fränkischen Herrschaft unterworfen und der Beschränkungen ihrer Gebiete überdrüssig, so dass sie verheerende Kriege mit den Thüringern und Sachsen führten, bis sie im Jahr 922 der erste deutsche König aus dem Sächsischen Hause, Heinrich I., glücklich bezwang. In das von ihm eroberte Daleminzien wanderten viele deutsche Ankömmlinge ein und gaben den von ihnen angelegten Dörfern deutsche Namen. Bald setzten die Erbauer zu ihren Familiennamen das Wort Wald, Dorf, Hayn u.a. dazu und so entstand bei uns Thalheim, Lampertswalde, Lampersdorf usw.
Der Sächsische König Heinrich gab seinem eroberten Land eine neue Verfassung, so dass die mit Oschatz verbundene Gegend unter den Markgrafen zu Meißen kam. Das Land behielt noch bis zum Jahr 1040 den Namen Daleminzien, erst dann bekam es den Namen Sachsen, aus der Markgrafschaft Meißen wurde nun das Kurfürstentum Sachsen.
In der Umgebung von Thalheim gab es viele Steinbrüche, in denen Porphyr abgebaut wurde. Die größten Steinbrüche waren bei Altoschatz. Abgebaut wurde hier aufgeschlossener Rochlitzer Quarzporphyr, ein vulkanisches Gestein der Rotliegendzeit (260-280 Mill. Jahre alt), das in diesem Aufschluß säulig abgesondert ist. Aus dem Porphyr wurden hauptsächlich Bau- und Pflastersteine hergestellt. Außer den Steinbrüchen gab es auch viele Sandgruben, deren Sand vielfach zum Häuserbau genommen wurde. Auch in Thalheim hat es eine Gemeinde-Sandgrube gegeben.
Zu den Stadtfluren der Stadt Oschatz gehörte u.a. auch die »Thalheimer Haide«, die in der historischen Beschreibung der Stadt Oschatz von C. S. Hoffmann aus dem Jahre 1815 wie folgt beschrieben wurde:
» Die Thalheimer Haide, nach 100 Acker, war sonst Lehde, rainet gegen Morgen mit des Raths vorgenannter Bürgerlehde, gegen Mittag mit dem Thalheimer Bauerholze, gegen Mitternacht zum Theil an die zum Ritterguthe Altoschatz gehörige Wiese und gegen Abend an die Lampertsdorfer Gehren.«
Bereits auf einer Karte Die erste Landesvermessung des Kurstaates Sachsen von Oeder, M. und Zimmermann, B. aus dem Jahre 1586-1607 ist das Bauerholz bei Thalheim eingezeichnet.
Ersterwähnung im Lehnbuch Friedrich des Strengen
Nachweislich erstmalig fand Thalheim seine Erwähnung 1350 im Lehnbuch Friedrich des Strengen von 1349/50, es wurde Talheym geschrieben. Diese Erwähnung steht aber nicht am Anfang der historischen Entwicklung von Thalheim. Thalheim gehörte auch zum Amt Döbeln, das zu damaliger Zeit mit einem Zipfel bis dicht an Oschatz heranreichte.
Im Lehnbuch Friedrich des Strengen lesen wir:
AUS DEN SCHRIFTEN
DER KÖNIGLICH SÄCHSISCHEN KOMMISSION
FÜR GESCHICHTE
DAS LEHNBUCH
FRIEDRICH DES STRENGEN
MARKGRAFEN VON MEISSEN
UND LANDGRAFEN VON THÜRINGEN
1349 / 1350
HERAUSGEGEBEN
VON WOLDEMAR LIPPERT und HANS BESCHORNER
MIT 9 TAFELN IN LICHTDRUCK
LEIPZIG
DRUCK UND VERLAG VON B.G.TEUBNER 1903
» Lehnbuch VI Einleitung CLXXIII«
» Die Ämter bildeten oft kein geschlossenes, abgerundetes Ganzes, sondern zeigten vielfach ganz sonderbar verlaufende Grenzen.« ... »Die Zürnerschen Karten in Schenks Atlas liefern anschauliche Bilder dieser grotesk gestalteten Ämter, allerdings nur für das 18. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert sehen aber die Ämter keineswegs einheitlicher und abgerundeter aus, wie aus dem Verzeichnisse von 1378 zur Genüge hervorgeht.« ... »Bei VII 16 und 17 würde man nicht verstehen, was Mahris und Thalheim in dem Amte Döbeln zu suchen hätten, wenn uns nicht Schenk, bez. Zürner darüber aufklärte, dass dieses Amt seiner Zeit bis dicht an Oschatz mit einem Zipfel heranreichte.«
VII. Döbeln S.52
17. »Item dominus contulit Friderico de Stopicz et Friderico de Gisilwicz in Hermansdorf
6 solidos grossorum annui census; item in Milanwicz 2 mansos; item in Talheym
4 solidos grossorum annui census, qui pertinet ad aratrum ipsorum.«
Adam Friedrich Zürner war ehemals Pfarrer von Skassa und beschäftigte sich nach Aufgabe seines Pfarramtes mit der Landesaufnahme. Er fertigte für August den Starken einen großen Atlas, den nachmaligen sogenannten »Schenk'schen Atlas.«
Das Lehnbuch Friedrich des Strengen, Markgrafen zu Meißen, Landgrafen zu Thüringen von 1349/1350, bildet für alle Zeiten einen Grundpfeiler für sächsische und thüringische Landesverfassung, »da es in fast alle Verhältnisse der Lande in einer Zeit hineinleuchtet, die für diese sehr wichtig ist.« Es ist eine reiche Fundgrube für die Geschichte des Lehnswesens, für Wirtschaftsgeschichte, Kirchenhistorie, Familiengeschichte, Volkskunde und auch für die Sprachwissenschaft.
Seit dem 10. Jahrhundert und bis zu den Anfängen des 19. Jahrhundert beherrschte das Lehnswesen den germanischen Staat politisch und privatrechtlich. Danach wurden in den einzelnen Ländern Ablösungsgesetze erlassen, die sich auf das Langobardische Recht »althekommen Recht und Gewonheit« gründeten und weiter schriftlich in den Lehnsrechtbüchern und im 14. Jahrhundert in dem Sachsen- und Schwabenspiegel niedergeschrieben wurden. Aus den Lehnsgütern gingen die späteren Rittergüter hervor.
Nachweisliche Urkunde aus dem Jahr 1352 und die Entwicklung danach Lt. dem Oschatzer Chronisten Hoffman (I.Teil S.231) eignete Friedrich der Strenge in einer Urkunde vom 2. März 1352 dem Kloster zu Seußlitz »das Patronatrecht über die Pfarre in Oschatz« ...»mit der Bedingung zu, dass alle Einkünfte davon seinen beyden Schwestern auf Lebenszeit, nach ihrem Tode aber den Klosterfrauen zu Seußlitz,«...»dienen sollten.«
Der Kloster-Convent zu Seußlitz bekennt im Jahr 1358, dass die gegebenen Einkünfte der Pfarrkirche zu Oschatz aus den Dörfern Thalheim, Poppitz, Blumberg, Lonnewitz, Schmorkau und der Stadt Oschatz nur den gedachten Prinzessinnen auf Lebenszeit zugeeignet, nicht aber dem Kloster einverleibet worden sind. Bis zu den Zeiten der Reformation besaß auch das Seußlitzer Kloster das Patronat-Recht über die hießige Stadtkirche.
Der Anteil Thalheims am Rittergut Saalhausen betrug im Jahr 1358 137 Einwohner in 25 Feuerstätten. »Dem Amte Oschatz steht Thalheim nur in Ansehung der Zinnsen zu. Es zinnset auch in das Oschatzer Kirchen-Aerarium 26 Viertel Korn und eben soviel Hafer« ... »welcher Zinns vor der Reformation dem Pfarrlehn zuständig war.«
Um die Weihnachtszeit 1429 hatten die Menschen großes Leid zu ertragen. Hussiten verwüsteten die ganze Pflege von Oschatz. Aber die fleißige und arbeitsame sächsische Bevölkerung hat ihr Heimatland immer wieder aufgebaut. Thalheim war schon immer unmittelbar mit dem Rittergut Saalhausen verbunden. Den bedeutendsten Aufstieg erlang der Bischof von Meißen, Johann VI aus dem Geschlecht derer von Saalhausen. In der Historischen Beschreibung der Stadt Oschatz von C.S. Hoffmann von 1817 II. Teil S. 331 lesen wir, das Thalheim der Geburtsort des Bischofs von Meißen ist und 1444, Freitags vor Martini geboren wurde.
Im Jahre 1487 kam er auf den Thron, gestorben ist er im April 1518 in Stolpen und begraben wurde er neben seinem Vater in Wurzen.
In der Geschichte der Stadt Mügeln und Umgebung, geschrieben von Magister J. G. Sinz um 1500, steht unter Abschnitt 39): »Johannes der Sechste von Salhausen, geboren zu Tammenhain 1444, wurde 1487 den 13. November zum Bischof gewählt.« Die Mügelner Kirche hat er fast aus dem Fundamento neu gebaut, (Abb. 5b) auch ließ er in den Jahren 1491 bis 1497 das Schloß in Wurzen errichten, welches Sitz der Stiftsregierung des Bistums Meißen wurde.
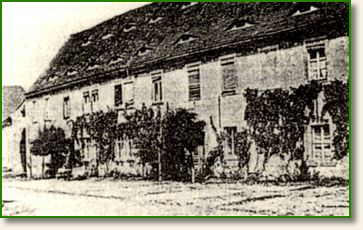 |
Das Rittergut befand sich bis Mitte des 15. Jahrhunderts im Besitz derer von Saalhausen. Danach war Baltasar von Grauschwitz der Besitzer des Saalhausener Rittergutes.
»Donnerst. Nach Misericordias Domini 1513 bekannte er, dass er, mit Gunst des Herzogs Georg, dem Rathe zu Oschatz 15 Rfl. Jährlichen Zins aus seinen Dörfern Thalheim und Lampertsdorf von 300 Rfl., jedoch auf Ablösung, verkauft habe.«
Durch das Kloster in Oschatz gab es im 15. Jahrhundert verschiedene geistliche Brüderschaften. Das waren z.B. die Brüderschaft der Jacobiten, der Schützenbrüderschaft, der Schneiderbrüderschaft u.a., es waren Vereine zur Beförderung der Andacht und Frömmigkeit. Das Dasein dieser Vereine beweist ein Testament der Witwe des Oschatzer Senators und Salzherrn Stephan Linke aus dem Jahr 1517, in dem Linken von Thalheim ein Bienenstock geschenkt wurde und in dem noch andere Vermächtnisse aufgeführt sind.
Im Jahr 1539 war Thalheim nach der kirchlichen Organisation nach Altoschatz gepfarrt. Seit 1555 ist Altoschatz das Filial (Tochterkirche) von Merkwitz.
1551/52 ist als historischer Ortsname Dolheim belegt und hatte folgende Einwohner: 22 bes.M. (besessene Mann), 1 Gtn. (Gärtner), 27 Inv. (Inwohner) mit 24 Hufen. Thalheim gehörte zum Verwaltungsbezirk Amt Oschatz, die Grundherrschaft hatte das Rittergut Saalhausen und Anteil Amtsdorf.
In Thalheim gab es ein Landrichtergut von 1 Hufe, es war mannlehn und zinsfrei und der Besitzer mußte das Landrichteramt unentgeltlich verwalten, ehe es in Erblehn verwandelt wurde. Am 16. Januar 1581 wurde es durch den Kurfürsten August an Elias Vogel gegeben und in Erbe verwandelt, da sich durch den Tod des vorherigen Besitzers die Lehn darüber erledigt hatte. Im Jahr 1582 besaß Hieronymus Freudiger aus Meißen ein Gut in Thalheim. Hier hielt er sich auf, als im November des Jahres in Oschatz große Sterbensgefahr war.
Bis zum Jahre 1632 bleibt Oschatz vom 30-jährigen Krieg verschont. Durch Zwangsabgaben, Einquartierungen und Plünderungen hatten die Einwohner der Stadt und umliegenden Orte schwere Belastungen. Infolge der Pest im Jahr 1637 starben in Oschatz über 2000 Menschen. Im Jahr 1696 hatte die Grundherrschaft über Thalheim das Rittergut Saalhausen und Anteil Amtsdorf.
Zum Rittergut Saalhausen gehörte auch »das Dorf Kreyscha von 26 Einwohnern in 9 Feuerstätten oder zwey 1/8 Hufen-5 Gärtnergüth. 1 Hause, 1 Mal- und Bretmühle. Diese Mühle von 5 Gängen ward zur Zeit des dreysigjährigen Krieges bis auf 1 Gang nebst Walk- und Bretmühle ruiniert.«
Bis 1835 war die Mühle in die Rittergutskapelle zu Saalhausen eingepfarrt, danach gehörte sie zur Parochialschule in Alt-Oschatz.
In der Mühle Kreischa wurde gg. 1838 eine große Wollgarn-Krempel- und Spinnfabrik errichtet. In der Zeitung »Oschatzer gemeinnützige Blätter« von 1840 bietet der damalige Besitzer der Mühle, ein gewisser Halm, verschiedenes zum Verkaufe an.
Seit 1911 finden wir in den Einwohnerbüchern der Stadt Oschatz neben dem Mühlenbetrieb die Bewirtschaftung eines Gasthauses. Damals war der Mühlenbesitzer und Restaurateur Silbermann, Emil.
 |
Die Mühle Kreischa wird ein beliebtes Ausflugsziel von Oschatz und Umgebung, bis sie 1973 stillgelegt wurde. Letzter Besitzer der Mühle und des Gasthofes war seit 1937 Selma Zosel.
Während des 7-jährigen Krieges nahm am 4. November 1759 General Daun Hauptquartier in Naundorf, die »Armee aber lagerte sich von Casabra an, bey Naundorf und Altoschatz vorbey, bis nach Striesa an den Wald.« Es ist anzunehmen, dass die Märsche auch durch Thalheim geführt haben. Der Krieg fand sein Ende mit der Unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen »Oestreich, Preußen und Sachsen zu Hubertusburg« am 15. Februar 1763.
Thalheim hatte 1764 an Einwohnern: 26 besessene Mann (ansässige Bürger), 26 Hufen je 14 Scheffel, die Grundherrschaft hatte das Rittergut Saalhausen und Anteil Amtsdorf, es gehörte zum Amt Oschatz.
Der Turm der Kirche in Altoschatz ist von der hiesigen Kirchfahrt aus ihren eigenen Mitteln im Jahr 1810 restauriert worden. Die schriftlichen Nachrichten über diesen Turmbau und den daran beteiligten Personen u.a. der resp. Bauvorsteher Thomas in Thalheim sind in dem Turmknopfe niedergelegt worden. Er hat die hier bewegten Baulichkeiten mit Umsicht und Fleiß geleitet. Weiterhin war er auch bei Reparaturen der Schule in Altoschatz beteiligt, denn in den Kirchenakten zu Merkwitz steht, dass an ihn dafür Geld ausgezahlt worden ist.
 |
Carl Gottlieb Thomas ist 1859 12 Jahre Gemeindevorstand in Thalheim gewesen. Außerdem war er tätig als Kirchvater in der Kirche Altoschatz, er war Bauer, Ortsrichter und Feuerpolizeikommissar für alle anliegenden Dörfer. Sein Bauerngut in Thalheim war das größte in der ganzen Kirchfahrt, außer den großen Gütern. Heute sieht man sein Bauerngut in Thalheim nicht mehr, es wurde abgerissen.
Bereits im Jahre 1810 war es üblich, durch öffentliche Aushänge und Anzeigen in der Zeitung der Bevölkerung bekannt zu geben, wenn jemand wegen zu großer Schulden seinen Besitz aufgeben mußte. So erfahren wir durch die damalige Anzeige von dem Liquidationstermin des »Hüfners Johann Gottfried Potscher zu Thalheim« und der Versteigerung des »Potscherschen Sieben - Viertelhufenguths zu Thalheim.«
Große Gemeindeplätze bei Thalheim, Ganzig, Oschatz, Wellerswalde u.a. hat man 1821 für den Obstbau genutzt, außerdem gab es hier noch die Bienenzucht. Thalheim zählte 1834 156 Einwohner.
Die Entwicklung der Schule
In die Schule in Altoschatz sind alle zu der ganzen Kirchfahrt gehörenden Schüler gegangen. Das waren die Kinder von Thalheim, Saalhausen und Kreischa. Das alte Schulgebäude wurde 1880 verkauft und auf dem Flurstück 423 von Altoschatz wurde ein neues Schulgebäude errichtet. Mit dem Gesetz vom 6. Juni 1835 nimmt der Staat die Volkserziehung als staatliche Aufgabe in seine Hand, die Schule besuchen 190 Schüler. Die Thalheimer Kinder benutzten zu dieser Zeit als Schulweg den Communikationsweg, den sogenannten Leichenweg, heute ist es der Laubenweg, nach Altoschatz.
Wie bereits berichtet wurde, sind die Kinder von Thalheim, Saalhausen und Kreischa in die Schule nach Altoschatz gegangen. Thalheim sollte jedoch ein neues Schulgebäude erhalten. Von dem Baumeister Dorn liegt eine Submission (Angebot) vom 2. Juli 1892 vor, dass er den Neubau der Schule »auf vorliegender Zeichnung und Bedingung fix und fertig und in bester Weise für den Preis von 16 692 Mark zur Ausführung« übernimmt.
 |
Das Königliche Ministerium des Kultus- und öffentlichen Unterrichts hat am 13. März 1893 beschlossen, den bis dahin tätigen Lehrer in Altoschatz, Karl Oskar Drese, zum ständigen Lehrer in Thalheim zu ernennen. Die Lehrerstelle wurde mit »1200 M jährlichem Gehalt und freier Wohnung« an der »neubegründeten Schule zu Thalheim genehmigt.« Durch die Königliche Bezirks-Schul-Inspektion wird der Schulvorstand am 21. März 1893 aufgefordert, einen Entwurf für eine »Localschulordnung« aufzustellen sowie einen Beschluß zwecks Überlassung des Schulgartens an den »ständigen« Lehrer in Thalheim zu fassen. Die Localschulordnung enthält z. B., dass der Schulbezirk die Orte Thalheim, Kreischa und Saalhausen, einschließlich das Rittergut, umfasst.
Es ist eine einfache, zweiklassige Volksschule. Die Schüler der ersten Klassen erhalten wöchentlich 18 Stunden, die Schüler der zweiten Klassen erhalten wöchentlich 14 Stunden Unterricht.
Am 30. Dezember 1915 wird für die Schulgemeinde Thalheim eine Schulsteuer festgelegt und der Steuerbedarf wird auf die Gemeinde Thalheim mit 54 %, die Gemeinde Saalhausen mit Kreischa mit 20 % und auf das Rittergut Saalhausen mit 26 % umgelegt. Die Schule gehört zur Parochie Merkwitz-Altoschatz und der Schulvorstand ist Herr Pfarrer Bammes, Hochwürden in Merkwitz.
Am 20. Dezember 1893 wird bereits durch den Localschulinspektor eine Revision in der Schule Thalheim durchgeführt.
Die Schule wurde in den 50er Jahren geschlossen und in dem Gebäude war von 1954 bis 1995 der Kindergarten der Gemeinde untergebracht. Hier wurde auch im Erdgeschoß, am 18. November 1977, eine Konsumverkaufsstelle eingerichtet, die nach der Wende als privater Lebensmittelhandel von der Familie Kühne bis 2006 weitergeführt wurde. Auch heute befindet sich dort noch eine Verkaufsstelle.
 |
Die Windmühle in Thalheim
Der unter das Patrimonialgericht zu Saalhausen gehörige Teil Thalheims besteht aus 27 Feuerstätten, 23 Begüterten und 4 Häuslern. Im Jahr 1837 waren es nach der Volkszählung 147 Bewohner und 11 Seelen im Oschatzer Amtsanteil.
Im Jahr 1839 wurde hier eine Windmühle erbaut. Auf einer Landkarte von Oberreit aus dem Jahre 1858 ist die Windmühle in Thalheim eingezeichnet, ebenso auf einer Karte von 1884. Im Grundbuch ist unterm 8. Juli 1840 als Besitzer des Grundstücks Carl Gottlob Zieschner eingetragen. Im Brandversicherungs-Cataster vom 27. März 1855 wird unter Haus-Nummer 28 Absatz b das ...Mühlengebäude ...versichert.
Unter dem 7. Dezember 1881 wird dem Windmühlenbesitzer, Herrn Zieschner, durch die Königliche Amtshauptmannschaft Oschatz eine Sondergenehmigung zum Mahlen von Getreide ausgestellt. »Erlaubniss - Schein ... Dem Windmühlenbesitzer Herrn Eduard Theodor Zieschner in Thalheim wird ... durch auf Ansuchen, jedoch nur bis zum Schlusse dieses Monats das Mahlen von Getreide an den einfallenden Sonntagen und am II. Weihnachtsfeiertage auch während des Gottesdienstes, am I. Weihnachtsfeiertage aber nur: bis 7 Uhr des Morgens, des Vormittags nach beendigtem Vormittagsgottesdienste bis Mittags 1 Uhr und des Nachmittags von beendigtem Nachmittagsgottesdienste an gestattet.«
Im Einwohnerbuch von 1895 steht als Windmühlenbesitzer ein Edmund Theodor Zieschner.
Durch den Thalheimer Gemeindevorstand Einbock wird am 29. Juli 1895 das Königl. Amtsgericht darüber informiert, dass im I. Halbjahr 1895 der Windmühlenbetrieb infolge Abtragung der Mühle abgemeldet worden ist.
 |
Auf dem Flurstück 549 der Oschatzer Flur wurde die Thalheimer Windmühle wieder aufgebaut. Besitzer des Grundstücks war von 1894 bis 1920 der Müller Ernst Julius Richter, bis es am 16. Dezember 1927 der Zimmerer Richard Paul Zieschner käuflich erworben hat. Im Einwohnerbuch der Stadt Oschatz aus dem Jahre 1927 steht unter Thalheim Nr. 28 Zieschner, Paul als Hausbesitzer und Bauunternehmer. Auf dem Grundstück hat 1929 Herr Otto Burkhardt gewohnt. Er beantragt unterm 7. April des Jahres einen Wandergewerbeschein für den Handel mit Fisch- und Grünwaren.
Durch Um- und Ausbau des Mühlengrundstückes erinnert nichts mehr an das alte Handwerk.
Der große Brand
Mehr als 200 Jahre blieb Thalheim vom Brandunglück verschont, aber Anfang Juli 1839 hat eine Feuersbrunst das Clemens'sche Gut in Asche gelegt. Im Brandversicherungs-Cataster von 1855 steht unter Haus-Nr. 14 als Gutsbesitzer Johann Carl Friedrich Clemens, aber ob es sich hierbei um ein und dieselbe Person und das wieder aufgebaute Gut handelt, ist nicht zu sagen. Vermutet wird von den Thalheimer Einwohnern, dass es sich um das Gut Peritz handelt, da dieses abgebrannt und neu aufgebaut wurde. Allerdings wissen wir durch den befindlichen Schlussstein über der Haustür, das der Bau dieses Hauses im Jahr 1889 beendet wurde und somit ein Zeitunterschied von 34 Jahren vom Brand bis zum Wiederaufbau besteht.
Nach der letzten Volkszählung im Dezember 1840 betrug der Anteil der Seelenzahl der Parochie in Thalheim 181.
Ein unter der sub. Nr. 15 des Brand-Catasters gelegene Landgut soll lt. der Zeitung »Oschatzer gemeinnützige Blätter« von 1840 versteigert werden. Bewirtschafter ist Taube in Thalheim. Außerdem lesen wir hier in einer Anzeige, dass der Gemeindevorstand Thomas für die Gemeinde einen zwei- bis dreijährigen Bullen zu kaufen sucht.
Es ist anzunehmen, dass schon damals gemeinschaftlich Rinder gezüchtet wurden. Vom 19. Juni 1908 gibt es nämlich eine »Satzung der freiwilligen Vereinigung zum Zwecke gemeinsamer Bullenhaltung in der Gemeinde Thalheim.« Hierbei geht es um die Züchtung weiblicher Rinder und die Regelung des für die freiwillige Vereinigung benötigten Zuchtbullen.
Thalheim gehörte im Jahr 1843 zum Amt Oschatz. Im Jahr 1848 lebten hier 185 Einwohner mit 28 Hufen. Zum Gerichtsamt Oschatz gehörte Thalheim im Jahre 1856.
In einer Landkarte von Oberreit, die im Jahre 1858 veröffentlicht wurde, ist ein Kohlenschacht zwischen Thalheim und Saalhausen eingezeichnet. Bei Abbauversuchen in 23 m Tiefe fand man mehrere Flötze Brandschiefer, den man jedoch wegen zu hohem Ascheanteil nicht als Brennmaterial verwendete. Das die Befugnis zu selbsteigener Aussuchung und Abbauung der befindlichen Lager von Stein-, Erd- oder Braunkohlen von Flurbesitzern aus Thalheim und Saalhausen an den Stadtrat, Herrn Carl Lampe zu Leipzig abgetreten wurden, steht in einem Vertrag vom 20. August 1843. »Zwischen umbenannten Contrahenten ist auf Grund bereits vorausgegangener Vereinbarung folgender zu Recht beständiger Vertrag in Schriften abgefaßt und niedergelegt worden:
§ 1 Namen der Contrahenten und Gegenstand derselben Nämlich es überlassen für sich und alle ihre Nachfolger im Besitze und Eigentum der jetzt von ihnen besessenen Grundstücke folgende Begüterte zu Saalhausen und Thalheim und Grundgesessenen da selbst, als:
a) von Saalhausen und aus dasiger Flur ... (11 Namen)
b) von Thalheim ... (16 Namen)
ihr Befugnis zu selbsteigener Aussuchung und Abbauung der etwa in ihren Grundstücken befindlichen Lager von Stein-, Erd- oder Braunkohlen, so wissentlich als wohlbedächtig und treten solches zur Ausübung ab, recht erbe und eigenthümlich an den Stadtrath Herrn Carl Lampe zu Leipzig.«
Der Stadtrat Carl Lampe versichert als Besitzer eines Maschinenhauses in Thalheim unter Haus-Nummer 30 im »Brandversicherungs-Cataster« von 1855 »a) das Maschinengebäude mit Wohnung und an der rechten Giebelseite angebautem Trinkhaus b) die Dampf... an die Rückseite von a) gebaut.«
In einer Bekanntmachung vom 2. August 1889 werden die Alteigentümer der Oberflächengrundstücke auf der Thalheimer Flur davon in Kenntnis gesetzt, dass der Kaufmann Dr. Carl Lampe in Leipzig das Bergbaurecht aufgegeben hat.
Zwischen dem Schulgebäude von Thalheim und dem ersten Haus von Saalhausen soll ein Eingang zum Kohlenschacht gewesen sein, wo sich die armen Leute nach dem 2. Weltkrieg Kohlen geholt haben. Bestätigt wird das durch ein Schreiben vom 25. Februar 1920, wo über eine Begehung zu den früheren Kohleschächten berichtet wird. Bohrlöcher vom Kohlenschacht sieht man noch heute auf dem Feld am Limbacher Weg.
In der Oschatzer Allgemeinen Zeitung vom 29.10.1999 wird darüber informiert, dass in Thalheim ein neues Wohngebiet an der Kreuzung »Zum Weißen Stein« - »Limbacher Weg« entstehen soll. Durch den ehemals stattgefundenen Bergbau wurde seitens der Stadtverwaltung Oschatz diesbezüglich eine Anfrage an das Bergamt Borna gestellt, um Kenntnis über evtl. Gefährdungen zu erlangen. Von hier kam die Antwort, »dass im Planungsgebiet in der Zeit von 1849 bis 1851 Bergbau umgegangen ist. Der ehemalige Tiefbau fand in 24 bis 40 Metern Tiefe statt.«
Der Gasthof in Thalheim
In der Zeitung »Oschatzer gemeinnützige Blätter« Jahrgang 1858 lädt »Freygang in Thalheim« zur Tanzmusik oder anderen Veranstaltungen ein.
Im Brandversicherungs-Cataster von 1855 steht unter Haus-Nr. 13b die »Schänkwirtschaft von Johann Gottlob Freigang.« Ob es allerdings der erste Betreiber eines Gasthofes in Thalheim gewesen ist, ist nicht bekannt.
Im Jahr 1884 war der Gastwirt Franz Robert Knof. Aber er hat nicht nur mit der Gaststätte seinen Lebensunterhalt bestritten. Für ihn wurde am 6. August 1885 ein Wandergewerbeschein ausgestellt, damit er für den Getreidehändler August Seifert in Oschatz Getreide in den umliegenden Nachbar-Ortschaften einkaufen darf.
 |
Ab 1927 wird Schober, Oskar als Gastwirt in den Einwohnerbüchern genannt. Durch seine Familie wurde diese Gaststätte bis 1995 bewirtschaftet. Heute steht den Einwohnern von Thalheim nur noch ein Bierausschank in der ehemaligen Bäckerei Kunze zur Verfügung.
 |
Das Armenhaus
Unter der Gebäude Nummer 13 ist in dem Thalheimer »Brandversicherungs-Cataster von 1855 Die Gemeinde« eingetragen. Das Gebäude war neben dem Gemeindehaus auch das Armenhaus der Gemeinde, da hier arme Leute gewohnt haben, aber auch der Nachtwächter von Thalheim, August Poitz, hat hier gewohnt.
Die Armenhausbewohnerin Wilhelmine verw. Gasch stellt am 5. Februar 1880 ein Gesuch für die Ausstellung eines Legimitationsscheines für den Handel mit angekauften Semmel-Waren von einem Mügelner Bäcker.
In den Einwohnerbüchern von 1922 bis 1937 steht, dass in dieser Zeit hier die Familie Dademasch gewohnt hat. Das Gebäude existiert nicht mehr, es wurde 1986 abgerissen. Heute befindet sich auf dem Grundstück ein Bungalow.
Thalheim hatte 1871 198 Einwohner und gehörte im Jahr 1882 zur Königlichen Amtshauptmannschaft Oschatz.
In einem Gesetz vom 5. Mai 1868 wurde bereits festgesetzt, dass bei Besitzveränderungen eine Abgabe zur Armenkasse zu leisten ist. Dem Gemeinderat Thalheim wird durch die Königliche Amtshauptmannschaft mit Schreiben vom 9. Februar 1882 bescheinigt, dass diese Bestimmung auf Zwangsversteigerungen keine Anwendung findet. In einer »Rechnung der Armencasse zu Thalheim vom Jahr 1888« wird abgerechnet nach:
A. Einnahme: Cap: I. Kassenbestand vom Jahr 1887
Cap: II. An eingefrorenen Kapitalien
Cap: III. An Beträgen von Hochzeiten, Kindtaufen, Begräbnissen u. Kommunionen
Cap: IV. An Zinsen von auf .....stehenden Kapitalien
Cap: V. An Beiträgen von Besitzveränderungen
Cap: VI. An Erbschaften, Vermächtnissen und ......
Cap: VII. An Abgaben von öffentlichen ......., Bällen und Tanzvergnügungen
Cap: VIII. An Strafgeldern
Cap: IX. An aufgebrachten .......
Cap: X. Insgemein
B. Ausgabe: Cap: I. An ausgeliehenen Kapitalien
Cap: II. An ...... Unterstützungen
Cap: III An Neubau-, Anschaffungs- und Reparaturkosten
Cap: IV. An Abgaben
Cap: V. Insgemein
Die Eisenbahn
Ein für die Region wichtiger Bau war und ist der Bau der »Sekundär-Eisenbahn« Döbeln- Mügeln-Oschatz. Verhandlungen über das davon betroffene Grundeigentum in den Fluren Thalheim, Oschatz, Flurteil Großforst, Saalhausen und Kreischa wurden am 27. November 1883 im Gasthause zu Naundorf geführt.
In der Zeitung Oschatzer Gemeinnützige Blätter vom 7. April 1884 wird folgende Anzeige gedruckt: »Tüchtige Erdarbeiter werden gesucht am Eisenbahnbau, Strecke Naundorf - Oschatz.« Dazu war es u.a. erforderlich, den Döllnitzbach zu verlegen. Für die in der Thalheimer Flur betreffenden Parzellentrennstücke wurde lt. Tabelle über Gemeindeabgaben - Restitution ein Erhebungssatz pro Steuereinheit von 103,70 festgelegt.
Am 7. Januar 1885 wird die Eisenbahnstrecke mit ihrer 750-mm-Spur feierlich eröffnet. Mügeln ist damit der größte Schmalspurbahnhof Deutschlands.
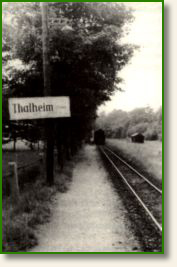 |
Die Bahnstation für Thalheim war bis zur Eingemeindung 1936 Kreischa-Saalhausen, dann stand am Wartehäuschen nur Thalheim (b. Oschatz). In einem Jahr beförderte der »Wilde Robert« zum Teil 430 000 Fahrgäste und viele haben bis heute schöne Erinnerungen an diese Zeiten.
Auf Grund des Verkehrsträgerwechsels nahm jedoch der Personenverkehr immer mehr ab und am 29. September 1975 fuhr der letzte Personenzug von Oschatz nach Mügeln. Seit 1976 fährt der Zug nur noch auf einer Strecke von 13 km.
Heute wird die Strecke Oschatz-Mügeln-Kemmlitz von der Döllnitzbahn GmbH betrieben.
Außerdem fürht der Verein »Wilde Robert« regelmäßige Sonderfahrten alten Dampfloks durch. Sie sind für Fans der Schmalspurbahn ein ganz besonderes Ereignis. Viele Schaulustige warten dann entlang der Strecke, um ihn besonders auf seinem Weg durch das idyllische Döllnitztal im Bild festzuhalten.
Das Vereinsleben in Thalheim
Durch eine Bekanntmachung in der Zeitung »Oschatzer Gemeinnützige Blätter« von 1895 wird durch den Jagdvorstand Einbock wegen der Jagdnutzung des Jagdbezirkes Thalheim eingeladen. Der Jagdbezirk umfasst ein Gebiet von ca. 510 Ackern. Diese Fläche soll jedoch nicht verkauft, sondern nur verpachtet werden. Wie weit sich diese Fläche ausgestreckt hat, ist leider nicht bekannt.
Aus den Adreß- und Geschäftshandbüchern vom Jahr 1911 und 1922 geht hervor, dass es hier auch den »Militärverein Concordia« gegeben hat. Durch ein Schriftstück der Königlichen Amtshauptmannschaft Oschatz vom 8. Juni 1905 erfahren wir, dass dem Militär-Verein zu Thalheim die Genehmigung für die Festlichkeiten vom 24.-26. Juni dieses Jahres aus Anlass der Weihe der Vereinsfahne erteilt wird. Wie lange es diesen Verein gegeben hat, kann nicht gesagt werden.
Es war auch nicht in Erfahrung zu bringen, ob oder wie lange es in der Gemeinde einen Kleingartenverein gegeben hat. Bekannt ist nur, dass für den 2. Februar 1924 alle Gemeindemitglieder in den hiesigen Gasthof zwecks Gründung eines Kleingartenvereins eingeladen wurden.
Wie es früher in vielen Ortschaften üblich war, wurden auch in Thalheim Kinderfeste und Kirmes gefeiert. Die Gasthofsbesitzer Freigang in Thalheim und Galle in Saalhausen haben schon im November 1858 durch Anzeigen in der Zeitung »Oschatzer gemeinnützige Blätter« zur »Kirmeß« eingeladen. Von einigen Bürgern wurde beschlossen, diese Tradition wieder neu zu beleben und seit 1985 findet deshalb jährlich Anfang Juni ein Heimat- und Kinderfest auf dem Kreischaer Berg statt. Dieses Fest ist zu einem kulturellen Höhepunkt des Ortes geworden.
Aus den Organisatoren dieser Veranstaltung gründete sich der Heimatverein Thalheim e.V. im Jahr 1993. Heute zählt der Verein 28 Mitglieder. Der Heimatverein fand sein Domizil in der ehemaligen Schule, hier trifft sich auch die Jugend des Ortes und der umliegender Gemeinden.
Am 8. Dezember 1943 wurde im Gasthof Saalhausen die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Thalheim beschlossen. In eine Liste haben sich 17 Freiwillige als Mitglieder eingetragen, heute zählt die FFW 11 Mitglieder. Als Gerätehaus wurde das ehemalige Leichenwagenhaus umfunktioniert. Eine Feuerlöschordnung für Thalheim gab es allerdings schon im Jahre 1864.
Die Gründung der Gemeinde Thalheim
Aus den Gemeinden Saalhausen mit Kreischa und Thalheim soll 1936 eine gemeinsame Gemeinde gegründet werden. In einer Niederschrift über die Beratung des Bürgermeisters mit den Gemeinderäten vom 2. Oktober 1935 wird dahin beraten, den Zusammenschluß abzulehnen.
Das es dazu nicht gekommen ist, geht aus einer Niederschrift vom 15. Januar 1936 hervor, in welcher der Bürgermeister die Übergabe der Gemeindeamtsgeschäfte im ehemaligen Gemeindeamt Saalhausen am 18. Januar 1936 bekannt geben wird.
Die Übergabe der Kasse der ehemaligen Gemeinde Saalhausen mit Kreischa erfolgte für die Zeit vom 1. Oktober 1935 bis 31. März 1936 mit einem Kassenbestand in Höhe von 840,33 RM. Durch den Zusammenschluss der drei Gemeinden wurden im Jahr 1937 477 Einwohner registriert.
Über die Landwirtschaft in Thalheim
Durch den Gemeinderat wird am 16. Januar 1934 Frau Anna Keilhau als Ortsbäuerin für 22 Bäuerinnen und Landwirtsfrauen ernannt.
Der Besitzer des Gutes Haida bei Limbach, Max Millington-Herrmann, hat an die Gemeinde Thalheim für das Jahr 1936/37 an Grundsteuer 196,93 RM bezahlt. Demnach hat er für seine Zwecke zusätzliche Gebäude und landwirtschaftliche Flächen benötigt
In einem Schreiben des Sächsischen Ministers für Wirtschaft und Arbeit wird der Bauer Max Müller zum Vorstand der Grundstückszusammenlegungsgenossenschaft für die Zeit vom 1. Januar 1941 bis 31. Dezember 1946 bestätigt. An diese Genossenschaft veräußern Thalheimer Bauern Teile ihrer landwirtschaftlichen Flächen.
1952 begann die Kollektivierung der Landwirtschaft , welche 1961 mit der »Zwangskollektivierung« abgeschlossen wurde. In Thalheim bildeten sich vier LPG Typ 1, »Glück Auf Thalheim«, »Bergfrieden« Kreischa, »Andreas Hofer« Saalhausen und »Deutsche Treue« Thalheim. Während sich »Glück Auf« und »Bergfrieden« später der LPG Typ 3, »Thomas Müntzer« Altoschatz anschlossen, gingen die »Deutsche Treue« und »Andreas Hofer« in die LPG Naundorf über.
 |
1969 wurden in Thalheim nur noch 503 Einwohner registriert. Der Rückgang der Einwohnerzahlen ist auf die Industriealisierung im Kreis Oschatz zurückzuführen. In dem neu errichteten Glasseidenwerk sind seit 1969 ca. 1300 Menschen beschäftigt und der VEBEKO baut ein Grundstufenwerk, wo ebenfalls viele Menschen arbeiten werden. Durch die Vergrößerung der Industriebetriebe entstand der Aufbau eines großen Wohngebietes in Oschatz-West und der Bau von Einfamilienhäusern.
Thalheim, mit seinen Ortsteilen Saalhausen und Kreischa, ist seit 1974 keine eigenständige Gemeinde mehr, denn es erfolgte die Eingemeindung zu Oschatz. In Thalheim befinden sich zwei Wohngebäude, die unter Denkmalschutz gestellt wurden. Das ist das Fachwerkwohngebäude der Familie Mehlow, Am Grund 15, und das Wohngebäude der Familie Wittenberg, Thalheimer Straße 34.
 |
Das Grundstück in der Thalheimer Straße gehörte im Jahre 1858 zu dem Besitz des Schankwirts Christian Gottlieb Galle in Saalhausen, 1874 einem Tuchfabrikanten aus Oschatz und 1879 dem Mühlenbesitzer Carl Heinrich Friede in Kreischa, bis es 1896 Emil Robert Silbermann in Kreischa mit 2 anderen Grundstücken samt Inventar vom Letztgenannten gekauft hat.
Das Grundstück wurde 1905 zergliedert und ging in den Besitz von Karl Richard Kottwitz in Altoschatz über, der hier 1905 das Wohnhaus so errichtet hat, wie wir es aus heutiger Zeit kennen. Hinzu wurden zahlreiche Wirtschaftsgebäude errichtet, u.a. eine große Scheune und ein Stallgebäude für die Führung eines Landwirtschaftsbetriebes.
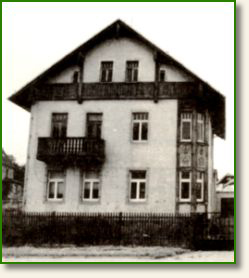 |
Infolge der Bodenreform wurde das Grundstück als Neubauernstelle vergeben. In den 50er Jahren wurde es als Wohnhaus durch die kommunale Wohnungsverwaltung verwaltet, bis es nach der Wende 1991 in Folge der Rückübertragung an die Alteigentümer zurück übertragen wurde.
 |
Nach der Wende wurde der ehemalige Gasthof Saalhausen abgerissen und als Wohnhaus wieder aufgebaut. Im Volksmund wird es das »rosa Schweinchen-Haus« genannt, wegen seines rosafarbenen Anstrichs.
Im Februar 2000 haben in Thalheim 629 Einwohner gewohnt...
